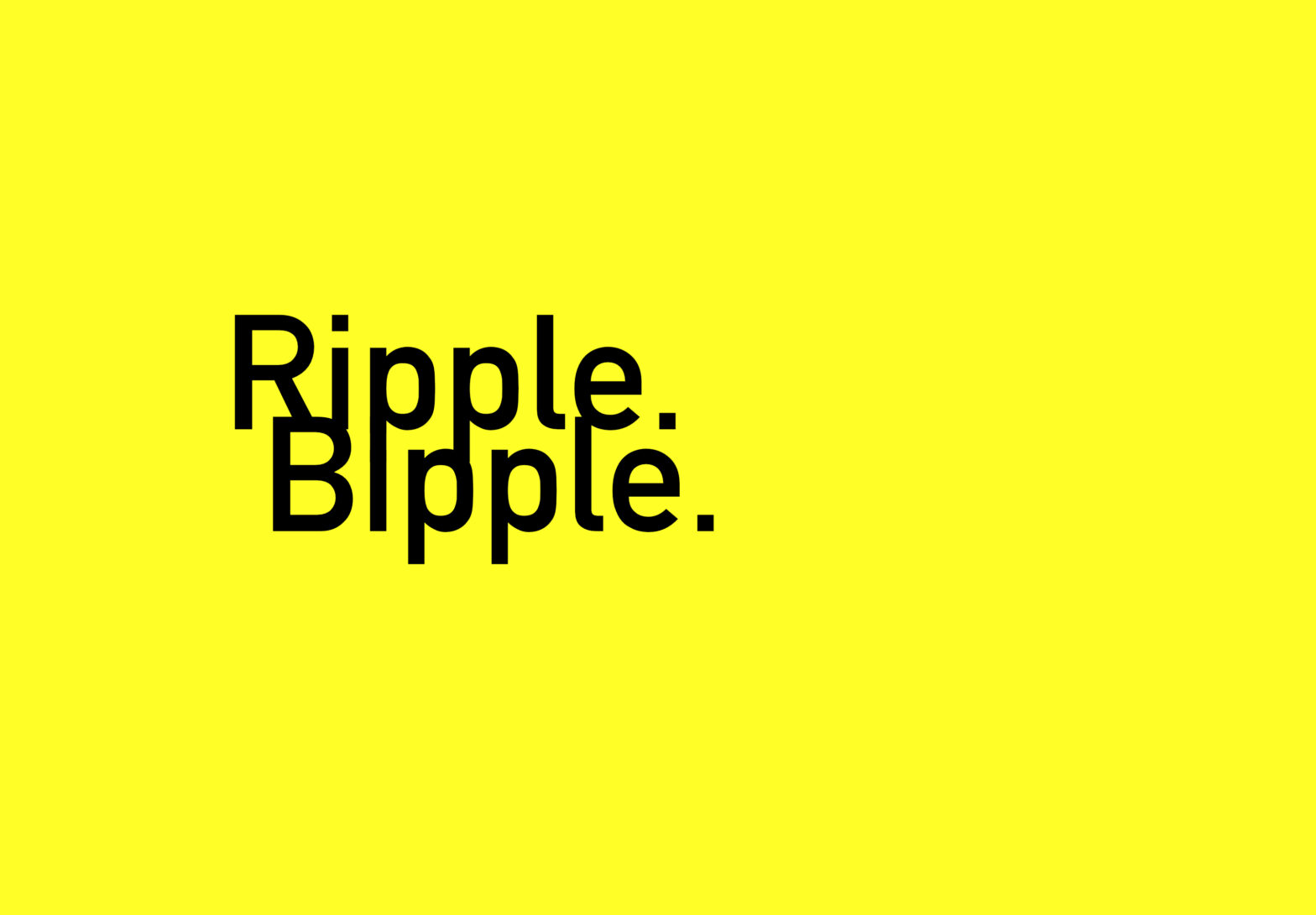Die schönen Stillen und das Zweifeln des zeitgenössischen Theaters
Man solle jetzt für fünf Minuten schweigen, sagt der Mann auf der Bühne, nachdem in den vergangenen 20 Minuten das totale Chaos die Bühne beherrscht hat, a bloody mess. Nur fünf Minuten, das wäre ja wohl machbar. Der Mann hält sich also den Finger vor die Lippen, blickt konspirativ ins Publikum und stellt den Countdown seiner Stoppuhr ein. Nur fünf Minuten. Aber kaum sind 10 Sekunden verstrichen, fragen aus dem Hintergrund zwei nackte Männer, sich einen Pappstern vors Geschlecht haltend, welche Art von Stille sie denn aufführen sollten? Die wunderbare Stille etwa, die nach einem Autounfall auf das Krachen von Blech folgt, die grandiose Stille, wenn das ächzende Beatmungsgerät auf der Intensivstation abgestellt wird, die unendlich stille Stille des Weltalls?
Ein unglaublich intensiver Theatermoment, in dem – paradoxerweise? – nichts passiert, das Nichts zur Aufführung gelangt. Die beiden Darsteller der englischen Theatergruppe Forced Entertainment erzählen sich groteske Geschichten über „beautiful silence“ in die Stille von Bloody Mess, so der Stücktitel, hinein. Geschichten über die Stille nach unerhörten Körperereignissen, Momente des Alltags nach dem Tod von Menschen, existenzielle Stillen, von Körpern, die nie wieder einen Laut von sich geben, nie mehr sprechen werden. Sie erzählen diese Geschichten gerade in jene Szene hinein, in welcher geschwiegen werden soll, kein Laut ins Theater verstreichen, kein Ton geäußert werden soll. Forcieren die Geschichte ins Absurde, übertreiben, indem sie die Stille selbst sprechen wollen.
Aber so komisch, lustig diese Szene auch ist, sie schließt diese Komik auf fast obszön-schöne Weise kurz mit der größten, unfassbarsten, unmöglichsten aller Grenzen, dem Tod, der eigenen Auslöschung. Das Wissen um die ewige Stille, die uns bedroht, berührt auf tragikomische Weise die Szene wie auch das Publikum. Diese Grabesstille, so sagen die beiden Darsteller eigentlich, kann man nicht darstellen, man kann nur über sie erzählen, ihre Unmöglichkeit vorstellen muss sich jeder selbst, in seinem eigenen Kopf: death in pictures, Bildbeschreibung.
Theater scheint hier zu seinem verzweifelten Ende zu kommen. Angesichts der eigenen Auslöschung erscheinen jegliche Versuche der Darstellung unglaublich lächerlich, in einem Theater, das nicht einmal in der Lage ist, Stille auszuhalten, Stille zu zeigen, weil immer wieder unterbrochen von Reden über die Stille. Theater kommt auch zu seinem Ende, weil es am Zeigen, Darstellen selbst immer wieder auf lustvolle, komische Weise scheitert. Das, was es darzustellen verspricht, die Stille, den Tod, gelingt ihm nicht, weil es diese möglichen Unmöglichkeiten nicht repräsentieren kann.
Diese schöne, stille Szene steht im Modus des Potenziellen, in welchem sich Theater mit dem Unmöglichen trifft. Wenn der Tod die Möglichkeit des Unmöglichen ist, weil wir uns weigern, unser Leben vom Ende her zu denken, wir aber dennoch existenziell wissen, dass wir von dieser Unmöglichkeit, ausgelöscht zu werden, dennoch eingeholt werden, dann zeigt zeitgenössisches Theater – vielleicht – die Unmöglichkeit alles Möglichen. Gerade weil auf dem Theater alles möglich erscheint, alles Mögliche passieren kann, verspricht es sich ständig. Es kann eben nicht alles Mögliche zeigen, weil es immer ein Mögliches auf der Bühne aktualisieren muss; weil es zu zeigen versucht, kann es dies lediglich im Wissen um die Undarstellbarkeit dieser Potenzialität. Theater ist damit immer von seiner eigenen Impotenz bedroht, vom Verstecken seiner Blöße, von Sternendarstellungen, die vor das nackte Gemächt gehalten werden, davon, in ein ewiges Schweigen zu fallen. Und aufgrund dessen muss es immer weiter sprechen, um diese Todesdrohung abzuwenden, sich der existenziellen Möglichkeit des unmöglich zu Denkenden, des denkbar Unmöglichen versprechen. Stille Schönheit.
In diesem Aufschub allerdings kann Theater nie am Ende ankommen. Es stolpert über sich selbst wie die Musiker über die Bänke, die Heiner Goebbels ihnen in seinem zeitgenössischen Musikwerk Schwarz auf Weiß zwischen die Beine, in den Weg stellt, schiebt den Sinn, den der Zuschauer gerne schwarz auf weiß nachlesen würde, auf die lange Bank, setzt ihn darauf ab, setzt ihn aus. Das Theater unterbricht sich, die Grabesstille schiebt sie auf, hält ihr den Atem der Sprache entgegen, man hört das Räuspern des Theaters, um erneut, zum wiederholten Male, ein unmögliches Grabmal, das Unmögliche des Möglichen zu sagen. Zu versprechen, dass es selbst nie zu Ende geht, dass das Selbst nie zu Ende ist. Wie bei diesem anderen Mann auf der zeitgenössischen Bühne, mit seinem dünnen, fast dürren, untrainiert wirkenden Körper. Ein Körper ohne Kopf. Auf dem Kopf. Ein Körper, der mutiert, sich bewegt wie ein Roboter, am Tisch zu murmeln anhebt, und schweigend von sich selbst berichtet. Der König selbst, upside down, unfinished: Xavier Le Roy, the saviour of theatre.
Wenn Forced Entertainment ihre Arbeit The World in Pictures mit einer Rede enden lässt, in welcher der erste Darsteller, der gleichzeitig der letzte ist, dem Publikum seine Vergänglichkeit ins Gedächtnis ruft, dann resoniert das Ende der Vorstellung selbst mit dem Ende des Selbst, lässt die Aufführung zu Ende gehen im Wissen um die Endlichkeit seiner Zeugen, selbst. Death is certain, so ein Titel einer performativen Installation von Eva Meyer Keller, scheint die Aufführung am Ende zu sagen, und doch führt sich dieses Ende so vital auf, so lebhaft, dass man an diesem Ende immer wieder zweifelt: selbst dieses Ende ist Theater.
Dieser existenzielle Zweifel ist der Motor von zeitgenössischem Theater, das keine Ruhe geben wird, nicht schweigen kann angesichts des unverständlichen, unsagbaren, unsäglichen Endes des Selbst. Welches Diskurse produzieren muss, unaufhörliche Texte, unablässig anreden muss gegen die Stille, um nicht bei sich anzukommen. Diese Zweifel an der Existenz macht eben nicht Halt vor dem eigenen Geschäft der Darstellung, der Selbstdarstellung von Theater, der Darstellung von Selbst im Theater. Es muss an diesem Selbst verzweifeln, gerade weil es dieses von seinem Ende her denkt. Es muss diesem Selbst immer seine Gegenwart entgegenhalten, das Selbst vergewissern, ihm ins Gewissen reden im Wissen über seine Endlichkeit.
Und dennoch vertraut das zeitgenössische Theater nicht mehr der traditionellen Sinnstiftung, wie diese jahrtausendelang im Medium der Sprache gesucht wurde. Vielmehr tritt Sprache hinter das Sprechen zurück, hinter seine eigentliche Äußerung, die immer ein Ent-Äußern von Sprache, ihrer Sinnstiftung ist, bei ihrer Stunde Null ankommt. Wie in Marthalers gleichnamiger Produktion, in welcher das Sprechen immer ein Versprechen, ein Scheitern an der eigenen Sprache bedeutet, ripple-bipple, bippleripplebipple, das ein Riddle, das ein Sprachrätsel ist einer Sprache, die, wenn sie über sich spricht, keinen Sinn mehr zu produzieren in der Lage ist. Bei sich angekommen, steht Sprache der Stiftung von Sinn am entferntesten. Sie versteht keine Antworten mehr zu geben auf die Fragen, die Herausforderung der Stille.
Im Wissen um diesen Zweifel am Sinn lauscht das Sprechen dem zeitgenössischen Theater dennoch ein forced entertainment ab, in seiner anderen, möglichen Übersetzung erzwingt es eine Unterhaltung, forciert ein Gespräch, das versucht, das Gesehene, Wahrgenommene zu übersetzen in den Gedanken, das Wort, die Rede, den Diskurs. Dieser Diskurs aber scheitert notwendigerweise an der Unübersetzbarkeit dieser Kunst. Er verfehlt sein Ziel, das Ästhetische, das immer ein Aisthetisches, ein Wahrgenommenes ist, für wahr zu nehmen und diese Wahrheit zu erklären. Das Sprechen ‚über’ scheitert im Zeichen dieser Proposition, weil sie die zeitgenössische Theaterkunst damit an eine Position, einen Ort zu stellen versucht, an welchem sie nicht ist. Denn der Sinnstiftungsversuch der Sprache vermag diese nur als Rätsel zu bestimmen, nicht aber den Sinnüberschuss dieses riddle, bippleripplebipple so zu überreden, dass er sich im Wort mitteilte. Es bleibt unfassbar im Versuch des Begreifens, sperrt sich dem Begriff: die Stunde Null von Sprache, die sich unendlich ausdehnt.
Zeitgenössische Theateraufführungen äußern sich gerade in der Entäußerung eines sprachlichen Sinns, geben in der scheinbaren Aufgabe von Sinn dem Sinn die nicht fertig zu stellende Aufgabe auf, einen Diskurs über die Sinnlichkeit zu fertigen. In ihrer Mitteilung der Mitteilbarkeit scheinen sie nichts Anderes als sich mitzuteilen, eine Mitteilung ohne Mitgeteiltes, und doch performieren sie theatralen, wahrnehmbaren, tiefen Sinn, indem sie diesen unaufhörlich perforieren. Aus diesen diskursresistenten Lücken schießt der Sinn der Aufführung heraus und überwältigt die Worte, bringt sie zum Verstummen. Auf diesen Widerstand des eigenen Sprechens, des Sprechens des Selbst, das kein Sprechen über das Selbst ist, reagiert der theateranalytische Diskurs mit einer Paralyse, einer Lähmung der Zunge. Die Sprache, die auf der Zunge liegt, in einer schönen Verschränkung von langue als Zunge und Sprache, bringt angesichts des Pfingstfestes der Aufführung nur ein Zungenreden zustande, schlägt an den Gaumen und verstummt. Wie gelähmt verzweifelt die (Fach-) Sprache an der Aktualisierung des Sinns, an der Unübersetzbarkeit des Sinnlichen, erörtert aber unaufhörlich gleichzeitig diesen Modus des Wie und treibt damit den eigenen Diskursmotor an. Deswegen muss die Analyse die ästhetische, schöne Stille unaufhörlich beschreiben, ständig forciert zu einem „this kind of silence, like…“, welches das beredte Schweigen des Zeitgenössischen in das Reich der Zeichen zu übersetzen versucht, irgendwie.
Der Diskurs verzweifelt daran, dass die sich dem Wortsinn verschließenden Aufführungen mehr wissen, ein Mehr an Wissen haben, als die Sprache an Wissen darüber produzieren kann. Für die Navigation auf diesem Mehr, auf diesem Meer hält die diskursive Karte nur wenige Anhaltspunkte vor, kaum eine Markierungsboje zeigt den Weg, der Wissensreisende muss mit einer weis(s)en Karte zurechtkommen, die ihm weder eine Passage noch einen Zielhafen zur Erlangung von Weisheit und Wissen anzugeben in der Lage ist. Dieses Wissen muss vielmehr in einer Geste des Suchens, im Navigieren durch ein mare incognita im Wortsinne er-fahren werden. Das Wissen ist flüssig, gleichzeitig liquide und liquidiert, weil es weder einen festen Ort hat, der als Kristallisationspunkt einen Zugang zu Wissen erlaubte, noch lässt es sich festmachen, in gesicherte Erkenntnis überführen, weil das Wissen im Sturm der Erkenntnis unterzugehen droht. Dieses Wissen dehnt sich als weißer Fleck auf der Landkarte des Meeres aus; es hat auf der Karte der Sprache keinen angestammten, vermessbaren Platz, erscheint ohne festen diskursiven Ort, atopisch.
Theorie im überlieferten Sinne von theoria, ‚zu sehen geben’ wird unmöglich, weil der Ort der Theorie, von welchem aus geschaut wird, im Riss der Erkenntnis verschwindet. Weil von dem Ort der Textproduktion aus keine Aussage über die ästhetische Wahrheit getroffen werden kann, sondern der Ort selbst topische Wahrheit hat. Die Wissensproduktion über Kunst muss selbst zu einer Kunstform werden, ohne verfasste Karte und ihre Legende, ihr zu Lesendes, navigieren. Aufgrund dieser von zeitgenössischem Theater verantworteten Zweifel an gesichertem Wissen befragen die Denkpraktiker, die Gedankenmacher eine Researchpraxis, die Tun und Denken verschaltet. Sie gehen davon aus, dass sie sich Gedanken nur machen können in einem gemeinsamen Raum, in welchem sich Kunst- und Denkpraxis treffen. Damit verwischen sich die Grenzlinien zwischen Praxis und Theorie; Theorie verstehen sie nicht länger als eine Form von Reden über Praxis, sondern bereits als eigene Praxisform. Dies situiert einen topischen Körper, der als Übermittlungs- und Speichermedium Wissen er-fährt und dieses in seinen Reflexionen in Bewegung setzt. In diesem Zweifel an atopischen, von außen kommenden Diskursen wird Reflexion in dieser sprachlosen Denkpraxis sowohl als Nachdenken wie auch, ausgehend von seiner ursprünglichen Bedeutung von reflectere = zurückbeugen, als Denk-Bewegung des Körpers selbst verstanden, der nie still gestellt ist, ruhig.
In der ständigen Befragung, der andauernden, Dauer, Raum und Aufmerksamkeit beanspruchenden Geste des Suchens stellt dieser Zweifel die Institution von Theater als Theater in Frage und hält sie gleichwohl in ständiger Bewegung. Sie stellt Theater als Verwaltung und Kunstorganisationsstätte in Frage und führt zu einem Zweifel an dessen sozialer Reichweite und seiner Konzeption als ästhetisches Medium, als Ort der Darstellung, als Aufführung von Gesellschaft, wie auch als Institution selbst. Theater kann nicht länger nur eine Abspielstätte von vorher gefertigten Produkten sein, sondern muss seine Türen öffnen, um dauerhafte Forschung und Wissensrecherche einlassen und aufnehmen zu können. Die Theaterökonomie der Aufmerksamkeit, die meistens auf die Aufführung als punktuell vermarktbares, singuläres Ereignis setzt, muss die Produktion von künstlerischem Mehrwert, der sich nicht länger mehr in der Aufführung abschöpfen lässt, in ihren Spielplangestaltungen berücksichtigen. Der Zweifel an Theater als Theater liegt begründet in der Skepsis gegenüber Repräsentation, beginnt bei der Frage: was heißt darstellen überhaupt?
Diese Frage bildet das Ausgangsparadox einer zeitgenössischen Theaterpraxis, deren Repräsentationszweifel dort zum Stehen kommt, wo der Zweifel im doppelten (deutschen und österreichischen) Sinne ansteht. Sie wird in zeitgenössischen Darstellungsweisen immer wieder aufgegriffen und verhandelt: Nichtklimaxorientierte Narrative, parataktische Nebeneinanderordnungen von Form und Inhalt, von Darstellung und Dargestelltem, Gestus des Zeigens und Vorführens, die ästhetisch weiterführende Aufspaltung von Akteur, Spieler, Figur und Rolle, Collagetechniken, ästhetische Verweigerungen von Medien und Körperbildern oder deren trashige Überbietungen sind einige Markenzeichen von zeitgenössischem Theater geworden. Dieses will sich aber keinesfalls in ihnen erschöpfen, sie als Markierungen und selbstvergessene Kodifikationen vor sich hertragen. Vielmehr unterzieht es diese ästhetische Strategien immer und immer wieder einer Befragung, um den potenziellen Modus des Darstellens, das Unmögliche des Möglichen, nicht in Genres, Stilen, Codes zu verfestigen.
Am ästhetischen Horizont von zeitgenössischem Theater wird nicht mehr nur eine Darstellung ohne Dargestelltes als Orientierungspunkt für Praxis und Research sichtbar, sondern selbst das Paradox einer Darstellung ohne Darstellung, eine paradoxale Figur von Theater ohne Theater. Ein Theater ohne Theater ist ein Theater der Ent-Setzung, ein afformatives Theater, welches Zwischenräume auslotet, in denen Darstellungs- und damit Wahrnehmungsdifferenz Platz nehmen kann, ohne Platz zu nehmen. Dieses Ohne ist damit kein Mangel an etwas, kein Defizit, das gefüllt werden wollte durch weitere ästhetische Strategien, es ist kein Minus. Dieses Ohne bildet die Grundlage für die Potenzialität von Theater, die in der Aufführungs-, Denk- und Organisationspraxis unaktualisiert bleibt, gleichwohl aber die produktive Bedingung von zeitgenössischem Theater markiert. Dieses Ohne ist kaum etwas, es lässt sich nicht konsumieren oder vermarkten, das Ohne ist aber nicht Nichts, weil es die Bedingungen in den Blick nimmt, unter welchen zeitgenössisches Theater in all seinen Ausprägungen auf Bühne, Probenstudio, Researchlab, aber auch bei den Zuschauern, Kritikern, Politikern, in der Stadt entstehen kann. Der Zweifel an Theater als Theater kommt in diesem Ohne gerade nicht zu seinem mangelhaften Ende, sondern bezieht seine Stichworte, seine Motivation und seine Energie gerade aus dieser Paradoxie.