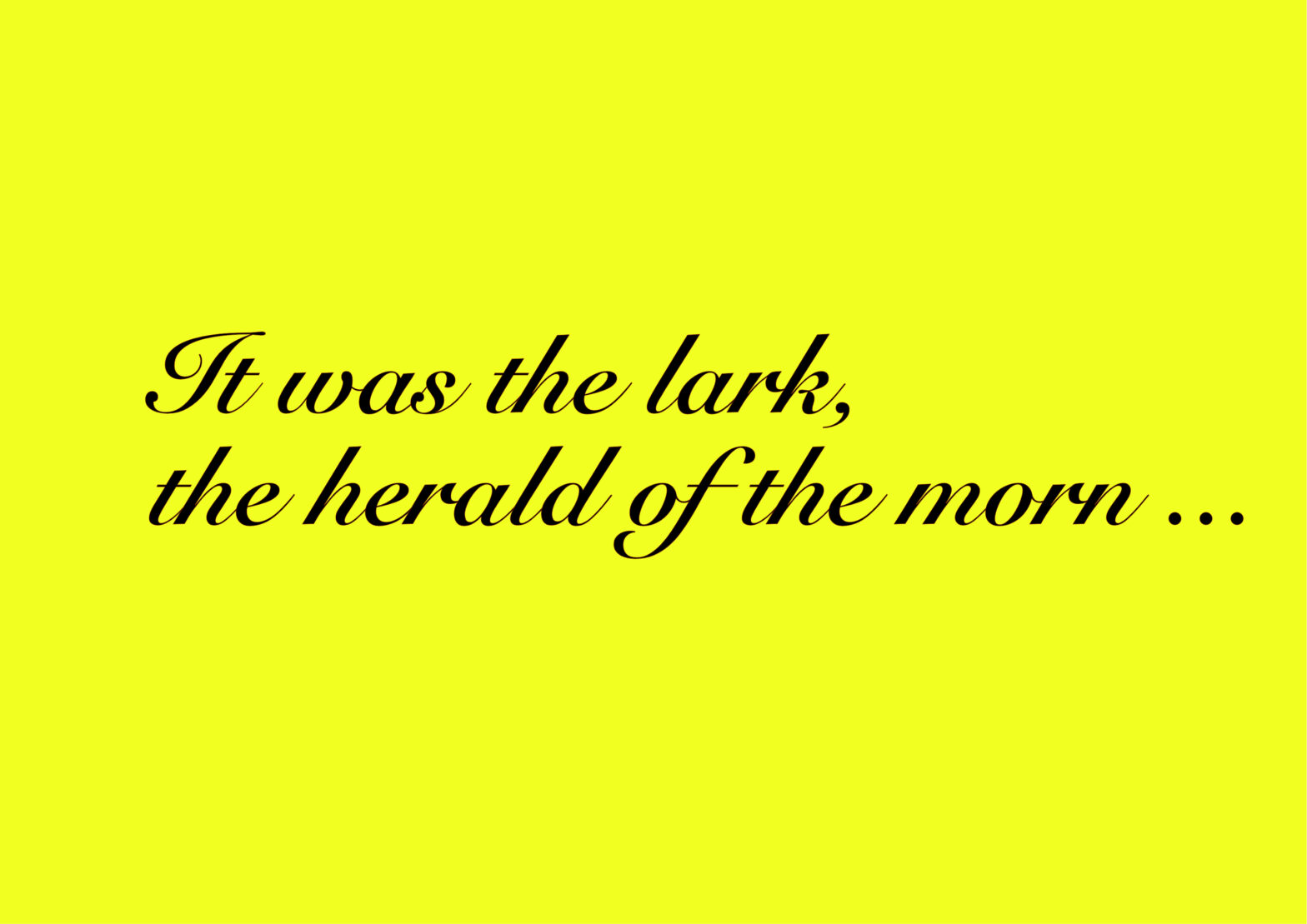Überlegungen zu fünf (un)möglichen Gesprächsinstallationen
Ein doppeldeutiger Begriff von Installation: Während der handwerkliche Installateur (engl. plumber) alles tut, damit Räume alltäglich benutzbar bleiben, nicht überschwemmt werden, produziert die künstlerische Installation Räume, in welchen sich ästhetische Erfahrungen alltagsüberschießend geradezu anschwemmen sollen. Die Gesprächsinstallation verfolgt damit ein unmögliches Klempnern, da sie nicht jene Leistung (Performance) erbringt, die ursprüngliche Ordnung durch einen Reparatur-Akt wiederherzustellen. Im Gegenteil sucht und schafft sie Bruchstellen, aus welchen die Materialität der (sprechenden) Körper austreten kann. Diese Materialität wird störend an einem Platze wahrgenommen, der gänzlich der Wirklichkeitskonstruktion durch Sprache, durch performative Sprechakte vertraut, wie dies Justiz oder Polizei tun. Die Sperrigkeit und Unübersetzbarkeit des Körpers in Sprache aber eröffnet andere Erfahrungsräume, andere Dimensionen der Wahrnehmung, die das Performative als soziales Theater an Ort und Stelle wieder neu installieren.
Das Verhören der Nachtigall. An einem Sommertag des Jahres 1963 wartete ein 38-jähriger im Verhörzimmer des Sheriffs der amerikanischen Kleinstadt Montgomery. Es war ein heißer Nachmittag, der Deckenventilator surrte, der Mann war durstig, aber guter Laune. Auch wenn etliche Verhörstunden hinter ihm lagen, in denen er aber beharrlich geschwiegen hatte. Im Nebenzimmer saßen vier erfolgshungrige Detectives, die ein Verbrechen aufzuklären hatten. Am Tag zuvor war eine junge Frau in einem Straßengraben nahe eines Parkplatzes gefunden worden, auf grausame Weise getötet. Zeugen hatten unabhängig voneinander auf dem Parkplatz einen weißen Buick mit fremdem Kennzeichen stehen sehen, in dem sie einen Mann vermutet hatten. Die Polizei verfolgte die Aussagen und machte den Halter und Fahrer des Wagens in einem Motel der Kleinstadt ausfindig. Es handelte sich dabei um jenen Klempner auf der Durchreise, der nun im Verhörzimmer auf seine Vernehmung wartete. Man wollte von ihm wissen, was er in dieser Stadt zu tun hatte. Der Hotelmanager berichtete, dass aus seinem Zimmer uneindeutig eindeutige Geräusche gedrungen seien, die auf Damenbesuch schließen ließen. Diese Information machte ihn zum Hauptverdächtigen. Die ermordete Frau war des Öfteren in diesem Motel gesehen wurden, sie hatte, wie der Manager meinte, einen zweifelhaften Ruf. Die vier Detectives, die allesamt ehrgeizig waren, berieten, was sie mit dem Hauptverdächtigen im Verhör anstellen sollten. Von diesem Fall hing viel für sie ab. Als sie die Türe öffneten und mit grimmigen Gesichtern in den stickigen Raum traten, blickte der Mann sie an. Einem der Detectives, er war der Älteste von allen, kam eine Idee. Er schickte seine Kollegen aus dem Zimmer, setzte sich auf die Tischkante dem Mann gegenüber und blickte ihm schweigend in die Augen. Er hatte sich entschlossen, so lange zu schweigen, bis der Verdächtige ein Wort sagte; er hatte von dieser seltsamen Strategie irgendwo einmal gelesen. Vorher stellte er nur die eine, die entscheidende Frage: „So, did you do it?“ Die beiden saßen Minute um Minute, Stunde um Stunde schweigend in diesem kleinen Raum, in dem nur der Ventilator seine surrenden Laute von sich gab. Es wurde dunkel im Zimmer, die Nacht brach langsam herein, in der Polizeistation herrschte Totenstille. Keiner der beiden bewegte sich. Sie schauten sich nur in die Augen, beobachteten sich, als würden sie sich hypnotisieren. Sie waren beide durstig, sie wurden hungrig, der Schweiß troff von ihren Stirnen, sie fühlten ein starkes menschliches Bedürfnis, doch keiner der beiden bewegte sich. High Noon um Mitternacht. Die Stunden verstrichen. Als es draußen dämmerte, hörte der Verdächtige einen Vogel zwitschern. Er lächelte in sich hinein und sagte, ohne den Blick vom Detective abzuwenden, mit brüchiger, trockener Stimme, weil er schon lange nichts mehr gesagt und nichts mehr getrunken hatte: „It was the nightingale, and not the lark.“ Er wollte dem Detective damit zu verstehen geben, dass er noch Stunden so sitzen könnte, ohne ein Wort zu sagen, auch wenn noch weitere Tage anbrechen sollten, wie dieser, der gerade seine ersten Laute von sich gab. Er fand sein Shakespearezitat aus seiner High-School-Zeit sehr clever. Romeo und Julia, 3. Akt. Szene 5. Ging es in diesem Drama nicht auch um ein Mädchen, das am Ende aus Liebe stirbt? Unvermittelt und ohne eine Regung im Gesicht stand der Detective auf, verließ den Verhörraum, ging im Nebenzimmer zu den mittlerweile wieder versammelten Kollegen und sagte: „Fred Nightingale did it.“ Und fügte trocken hinzu: „He sang like a bird.“ Der verdächtige Klempner hatte nicht mit dem unscharfen Gehör des Detectives gerechnet. Dieser hatte die Worte des Mannes folgendermaßen verstanden: „It was nightingale, and that’s no lark.“ („Es war Nachtigall, und das ist kein Witz.“) Natürlich wurde der Verdächtige, konfrontiert mit dem vermeintlichen Geständnis, in den kommenden Stunden und Tagen sehr gesprächig, er dementierte umgehend, sagte, es handele sich dabei um ein Sprichwort, schaltete einen Anwalt ein, der alles in seiner Macht stehende tat, um die Polizisten und den Staatsanwalt zu überzeugen, dass sich der alte Detective verhört habe, dass es sich um einen Scherz gehandelt habe, ein Zitat von William Shakespeare, ein Drama. Leider waren da aber noch die Indizien, die gegen Fred, den Klempner, sprachen. Auch wenn es keine hieb- und stichfesten Beweise gab, die gegen ihn vorzubringen waren, so konnte doch die Indizienlage gegen ihn in Anschlag gebracht werden. Die Geschworenen verurteilten Fred Nightingale aufgrund von Indizien zu einer lebenslangen Haftstrafe. In ihrer Urteilsfindung bezogen sie sich auch auf die erste Aussage des Angeklagten und werteten es als Schuldeingeständnis, das der Angeklagte später im Zuge der Ermittlungen nur aus Angst vor der Bestrafung zurückgezogen habe. Nightingale wurde nach 15 Jahren wegen Verfahrensfehlern begnadigt, starb aber kurz vor Beendigung seiner Haftstrafe im Gefängnis.
Verhörte Aussagen. Fred Nightingales Verurteilung sollte als Romeo-Fall in die Klassikergeschichte der amerikanischen Kriminologie eingehen. Fred war im juristischen Sinne, wie sich bei Verfahrensüberprüfungen schnell herausgestellt hat, des Verbrechens nicht schuldig. Leider hatte man zur damaligen Zeit keine moderne Beweisführung an der Hand. So genügte es, zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort zu sein, um Indizien gegen ihn zu verwenden. Hätte er nun im richtigen Moment geschwiegen und sich seiner vermeintlich geistreichen Bemerkung enthalten, Fred Nightingale wäre wohl heute noch am Leben. Dass sich der ehrgeizige Beamte ausgerechnet im kriminalistischen Verhör verhört hat, gehört sicherlich zu den Treppenwitzen der Polizeigeschichte. Gleichwohl war diese akustische Fehlleistung einer Rahmenerwartung geschuldet, die der Polizist mit seiner unkonventionellen Strategie bedienen wollte. Im kriminalistischen Verhör zählt jedes Wort des Verdächtigen, das immer nur innerhalb des Erwartungsrahmens verstanden werden will. Freds Wortspiel bezog sich jedoch auf einen Rahmen, der ganz sicher außerhalb des Verhörzimmers lag, er hatte mit dem Vogelzwitschern etwas gehört, für das nur er Ohren besaß. Innerhalb des Verhörrahmens aber konnte das von ihm Gesagte nur als seine Aussage gewertet werden, als sein Geständnis auf die eingangs gestellte Frage. Auch wenn der Detective sich verhört hat: Fred Nightingale wurde seine eigene Fehleinschätzung des Diskursrahmens der polizeilichen Ermittlung zum Verhängnis; seine Aussage war die sein eigenes Ende ankündigende Lerche.
Das schiere Reden kann also beträchtliche Konsequenzen für Leib und Leben nach sich ziehen. Wer vor Gericht beispielsweise einen Meineid ablegt, muss mit harten Folgen rechnen; auch wenn ein Zeuge oder Angeklagter nur etwas so dahinsagt, fahrlässige Angaben macht, kann er dafür belangt werden. Sprechen bedeutet in juridischen Zusammenhängen fast immer, für die Folgen der eigenen Rede einstehen zu müssen. Wenn das Gesetz ermittelt, sollte man die Wahrheit sagen oder zumindest das, was man tatsächlich für die Wahrheit hält oder was als Wahrheit Anerkennung findet. Hat ein Gericht oder ein Richter einmal ein Urteil verkündet, so sind die Konsequenzen für den Angeklagten direkt und unvermittelt. Seine sprachliche Verkündung ist einer Handlung gleichzusetzen, sie beschreibt nicht einfach, was sie tut, sie tut es selbst.
Diese ‚performativen Sprechakte’, als solche vom amerikanischen Sprachphilosophen John L. Austin so genannt, unterscheiden sich von ‚konstativen Sprechakten’ dahingehend, dass letztere lediglich eine Beschreibung von Sachverhalten abgeben. Performativa tun etwas, indem sie gesagt werden: Der Pate, der ein Schiff tauft, der Priester, der zwei Menschen ‚vor Gott’ zu einem Paar erklärt, oder eben der Richter, der den Angeklagten zu Tode verurteilt. Allerdings sind diese Sprechakte eingebettet in bestimmte soziale Zeremonien, lokale Kontexte, festgeschriebene Rituale, die nur von bestimmten, autorisierten Personen vollzogen werden dürfen. Außerhalb dieser Rituale, von Laien geäußert, wäre dieses Sprechhandeln wirkungslos. Wenn ein Priester zwei Menschen in seinem Büro traut, ist dies genauso folgenlos wie die Urteilsverkündung eines Rechtsreferendars im Gerichtssaal. Hätte Fred Nightingale seine kleine Äußerung in der Kneipe nebenan gemacht, während der Detective vor ihm auf der Tischkante gesessen wäre, diese wäre ohne Folgen für ihn geblieben. Hinzu kommt, dass einmal geäußerte Performativa nicht mehr von den sie äußernden Personen zurückgenommen werden können. Ein Schiff darf erst den Namen wechseln, wenn der Besitzer wechselt, der Priester darf die Ehe nicht scheiden, dafür ist der Tod zuständig, und der gleiche Richter darf ein einmal von ihm gesprochenes Urteil nicht aufheben, das muss ein nächst höheres Gericht für ihn erledigen: Die Sprechhandlung ist auch für die Redner handlungsbindend.
Man könnte sagen, dass Performativa nicht nur im direkten juridischen Sinne Gesetzes- und Urteilskraft erlangen. Wer während einer Auktion oder an der Börse das Wort ‚kaufen’ ruft, hat in jenem Moment einen Vertrag geschlossen, aus dem er nicht wieder herauskommt. Wer erklärt, er schenke einen Gegenstand einer anderen Person, muss sich Einiges einfallen lassen, um die gemachte Schenkung rückgängig zu machen. Wer mit jemandem leichtfertig eine Wette eingeht, indem er, einfach so, auf einen in der Zukunft liegenden Vorgang wettet, muss sich auf die Kulanz des anderen Wettpartners verlassen, wenn er diese Wette wieder auflösen will. In jedem Fall muss der Sprechhandelnde eine andere Diskursinstanz anrufen, wenn er die Wirkung performativer Sprechakte aufheben möchte, er muss die Bedingungen, unter welchen diese Sprechakte geäußert wurden, glaubhaft verlassen. Das gelingt allerdings nur, wenn die Bedingungen, unter welchen diese Performativa funktionieren, gänzlich in Frage gestellt werden, wenn das Diskurssystem, das die Reichweite und den Wahrheitsgehalt der performativen Sprechakte regelt, gewechselt, verlassen, aufgegeben wird; wenn der Sprechrahmen, in welchem das Sprechhandeln getätigt wurde, in Zweifel gezogen und für ungültig erklärt werden kann. Allerdings muss dieser Sprachsystemwechsel von allen Sprechern vollzogen werden, was nicht immer gelingen mag (s. Fred Nightingale): Todesurteile, die in einem Unrechtsregime gefällt werden, können aufgrund der Illegitimität des juristischen Systems nachträglich aufgehoben werden (wie im Falle der Übernahme eines Staates durch einen anderen); die vor Gott geschlossene Ehe wird annulliert, weil die grundsätzliche Zulassungsberechtigung nachträglich aberkannt wurde (wie im Falle von Caroline von Monaco); die Wandlung der Hostie in den Leib Christi wird nicht anerkannt, sondern nur als symbolische Erinnerung an den Tod Christi verstanden (die Geburt der evangelischen Kirche); eine Schenkung oder Wette wird nachträglich als Jokus (the lark = der Jux) deklariert (wie der kürzlich bereits als sicher geglaubte Gewinn des Autors dieser Zeilen, der durch ein vermeintliches Augenzwinkern des Wettpartners für nichtig erklärt wurde). An diesen Stellen endet der soziale Vertrag der Sprache und der des Sprachspiels beginnt.
Wahre Lüge. Der italienische Romancier und Sprachphilosoph Umberto Eco bezeichnete als ein Hauptmerkmal von Sprache deren Kompetenz, lügen zu können. Nach sprachwissenschaftlicher Überzeugung sind Sprachzeichen arbiträr, also willkürlich, weil sie nur aufgrund eines Codes, der sozialen Vereinbarung einer Sprechergemeinschaft, Wirklichkeit beschreiben. Entsprechend ist jedes Zeichen, wie die Sprachgemeinschaft eben auch, in ihrer Inhalt-Aussagen-Relation Veränderungen unterworfen. Zeichen sind, folgt man Eco, erst dann Zeichen, wenn sie auch andere Sachverhalte bezeichnen könnten als jene, für die sie gewöhnlich stehen.
Im ‚Flunkern’, ‚Lügen’, ‚Herausreden’, ‚Heucheln’, ‚Vorspiegeln’, ‚Verstellen’ fallen sozialer Rahmen, psychologischer Wunsch und sprachliches Tun zusammen. Zu lügen heißt, einen anderen Rahmen zu setzen um das, was man Wirklichkeit nennen könnte. Lügen verändert oder will die Wirklichkeit durch Sprache verändern. Sie versucht Tat-Sachen zu schaffen, indem sie der Sprache vorgängige Sachverhalte beugt, fehlinterpretiert, absichtlich verdreht. Wenn der Angeklagte also den Richter belügt, versucht er einen anderen Wirklichkeitsrahmen zu setzen, der, wenn er sich als falsch herausstellt, konsequent strafverfolgt wird. Wenn der Ehemann seine Frau belügt, weil er sie gerade betrogen hat und er einen anderen Grund für seine nächtliche Abwesenheit vorträgt, dann gilt diese Wirk-lichkeit so lange, wie seine Frau ihm glaubt oder Glauben schenken möchte. Seine lügnerische Sprache stellt damit eine Tat-Sache her: Die Sprache der Lüge ist keine Tat, sondern die Konstruktion von Tatsachen. Sie konstruiert andere Fakten, die wahr sein könnten (die beste Lüge ist bekanntlich die, deren Wahrheitsbedingung womöglich glaubhafter ist als die faktische Wahrheit selbst) und ändert die Rahmenbedingungen des Sprechens insgesamt. Die Lüge sagt, dass sich etwas auch ganz anders verhalten könnte, dass ein Sachverhalt unter Einbeziehung anderer Parameter und Perspektiven mit Hilfe von Sprache auch anders dargestellt werden kann.
Zieht man nun von der Lüge die moralische Komponente ab, mit welcher der Begriff besetzt ist, lässt die ethische Dimension der Wahrheit einmal beiseite und betrachtet die Lüge nur aus der Perspektive der Sprache, so ist der Sprechmodus ‚lügen’ die kreativste Weise der Sprachverwendung, Wirklichkeit herzustellen, die ihre Herkunft aus der Fiktion, der Erfindung zu verschleiern versucht. In der Lüge findet sich das Theater der Sprache wieder, ihr ureigenster Erfindungsgeist, der eine soziale Szene mit der Kraft der Worte herstellt, die so nie stattgefunden hat. Im Lügenakt, diesem besonderen Modus des Sprechens, gelangt Sprache auf die Szene, die sie herbeiredet.
Im Unterschied zum performativen Sprechakt destabilisiert die Lüge die Gegebenheiten der Umwelt, während Performativa ausschließlich in jener Stabilität funktionieren, die sie durch ihr Handeln aufrecht erhalten. Während damit die Taufe oder das Urteil kraft eines stabilen sozialen Gesetzes Gesetzeskraft erlangen, erschüttert der ‚mentiologische Sprechakt’, wie jener der Lüge genannt wird, gerade das Vertrauen in die Festigkeit einer sozialen Vereinbarung, weil er an deren Stelle eine andere treten lassen möchte. Will der performative Sprechakt handeln und damit unhintergehbare Tatsachen schaffen, indem das Sprechen einer Handlung gleicht, so suggeriert der mentiologische, dass die Tatsachen gerade hintergangen werden können, indem sie kreativ verdreht oder verändert werden. Ist das eine Ein-Tun-durch-Sprechen, so sagt das andere eine Tat. Während ein performativer Sprechakt nie lügen kann, weil er die Tat selbst ist, so kann jedes andere Sprechen gelogen sein: jede Beschreibung durch Sprache, also die konstatierende Deskription von Vorfällen (Zeugen), die Wiedergabe von Erlebnissen (Bericht), die Beschreibung von emotionalen Zuständen (Gefühle) kann gelogen sein, kann täuschen über den Sprecher, das Objekt seiner Rede, die Absichten, die Geständnisse.
Die Wahrheit und der Ort, an welchem sich diese lokalisiert, sind auf diese Weise unauflösbar sozial miteinander verschlungen. Sprechen und Gemeinschaft, Diskurs und Sozietät sind hier eng miteinander verzahnt, weil das soziale Umfeld, von welchem aus performativ gesprochen werden kann, gerade erst durch diesen Sprechakt hergestellt und gefestigt wird. Jede Abweichung davon bedeutet nicht nur die Aufkündigung des Sprechvertrags, sondern auch das Aufweichen an der diesen stiftenden, von diesem gestifteten Gesellschaft. Die Orte, an welchen Performativa gesprochen werden, können demnach als Orte der Wahrheit oder Wahrheitsfindung verstanden werden. Alle nicht-performativen Orte wären demnach Orte, wo immer auch die Möglichkeit herrscht, dass die Lüge das Faktische aushebelt und eine andere Wahrheit kreiert. Der Kontrakt, die Wahrheit zu sagen, verschiebt sich an diesen anderen Orten zu einem Vertrag des Wahr-Sprechens; während die erste Vereinbarung davon ausgeht, dass die Wahrheit gesagt werden kann, weil sie fall-objektiv ist, weil es sie schlicht gibt, setzt die mentiologische Variante das Wahre als einen Akt des Sprechens – Wahrheit muss lediglich gesagt werden. Sie ist lediglich eine Funktion von Sprache, ein hergestellter Sprechzusammenhang, in welchem die Wahrheit gesagt wird. Entsprechend fällt der vermeintlich unüberwindliche Gegensatz von Wahrem und Falschem in sich zusammen, es ist nur eine Frage des ‚Wahrsprechvertrages’, nicht aber eine der Sprache vorgängigen sozialen Situation. Der privilegierte Ort der sozialen Wahrheit ist damit das Gericht, die Kirche, das Sprechzimmer des Arztes, der privilegierte Ort des dynamischen Wahrsprechens, also der potenziellen Lüge wären umgekehrt der Küchentisch, das Ehebett, der Arbeitsplatz oder – das Theater.
Selbst-Anders. Theatralität im Sozialen. Ironisch genug, dass sich Nightingale, eines Wortspiels mit seinem Nachnamen bedienend, ausgerechnet ein Zitat aus ‘Romeo und Julia’ ausgesucht hat, dessen Tragik gerade im Missverständnis, der falschen Wahrnehmung von Informationen und der Fehlwahrnehmung des Gegebenen aufbaut. Leben und Theater treffen sich hier also auf merkwürdige Weise. Dort, wo das Leben endet, beginnt nun die Theaterszene. Dieses Theater, in welchem zwei Figuren einen missverständlichen Dialog führen, entfaltet sich gerade in der Fehlaneignung von sozialen Rahmen. In dieser Rahmenaneignung wird Theater als theatrales Medium sichtbar und entwirft für sich eine andere Wirklichkeits- und Existenzweise. Hierin liegt das Potenzial von Theater und Theatralität begründet.
Geht man von der Minimaldefinition von Theater aus, wonach mindestens ein Zuschauer mindestens eine von einer Person verkörperten Figur betrachtet, wird deutlich, dass für die Konstitution von Theatralität im Wesentlichen nur zwei situative Parameter vonnöten sind. Zum einen rahmt der Blick einer anderen, nicht in das jeweilige Geschehen involvierten Person die Szene auf eine Weise, dass sie für den Beobachter nicht die gleichen Konsequenzen hat, wie für die an dieser Szene Beteiligten. Der unbeteiligte Zuschauer blickt, ohne handeln zu müssen; sein eigener Blick markiert ihn, den Zuschauer, als handlungs-entlastet. Zum anderen setzt der Zuschauer die handelnde Person seinem Blick aus. Seine Anwesenheit macht der Person bewusst, dass sie beobachtet wird von jemandem, der selbst nicht an der Handlung beteiligt ist. Entsprechend wird sich diese Person, gespiegelt durch den Zuschauerblick, selbst als Schauspieler wahrnehmen. In dieser Selbstwahrnehmung liegt bereits die allererste theatrale Differenzierung: die Person nimmt sich als jemand Anderes wahr.
Diese Eigenwahrnehmung der Person als Selbst-Anders, als gleichzeitig sich und doch ein anderer zu sein, muss nun nicht ausgelöst werden durch die körperliche Anwesenheit des Zuschauers. Sie kann genauso gut bedingt sein durch eine von der Person nach innen genommenen Außenperspektive, als imaginierte sie sich einen Beobachter. In dieser bewussten, kognitiv kontrollierten Selbst-Andersheit lässt sich die Person zugleich ‚sich selbst’ sein wie auch nicht-sich-selbst. Sie kann nunmehr mit ihren Identitäten spielen, Rollen annehmen, Sprechen, als sei sie nicht sie: Freds Romeo-Zitat ist die Aneignung einer Sprechmaske, entlehnt von einer Figur des klassischen Theaters, von welcher Nightingale selbst weiß, dass er sie lediglich zitiert, dass er ihren Satz lediglich sagt, nicht aber meint. Das bewusst spielende Ich, das genausogut ein spielendes Nicht-Ich ist, spricht demnach immer im ästhetischen Modus, der auch ‚Lügen’, als faktische Unwahrheit, einschließt. Da Fred in dem Zitat Romeo ‚gibt’, kann er gar nicht mehr DIE WAHRHEIT sprechen und verfehlt notwendigerweise den Geständnishorizont, in welchen er vom Detective gestellt wurde. Der Detective wiederum muss sich gerade einer Selbst-Andersheit entraten, weil die Wahrheit, die er sucht, nicht vieldeutig, kein Spiel ist. Er kann nur in seiner ihm zugewiesenen Autorität des Polizeibeamten ermitteln, die nicht verhandelbar ist, weder dem Verdächtigen, sich selbst und dem Gesetz gegenüber.
Die Selbst-Andersheit in gegebenen sozialen Situationen, das Spielpotenzial des darin agierenden Subjekts nimmt das Gegebene nicht nur faktisch, sondern potenziell wahr: es könnte auch anders sein. Sie ästhetisiert das Soziale und rahmt es mit einem theatralen Blick, der soziale Handlungen als mögliche, nicht aber notwendig ausschließliche betrachtet. Der theatrale Blick ist in der Lage, zwischen dem Gegebenen und dem Möglichen, dem tatsächlichen und fiktiven Raum, zwischen dem Gesagten und dem Gemeinten, zwischen dem Sozialen und Ästhetischen hin- und herzuschalten. Die selbst-anders theatralisierte Person verfugt, um es mit Musil auszudrücken, den Wirklichkeits- mit dem Möglichkeitssinn. In dieser Doppelung des Sozialen im Ästhetischen, in der Ästhetisierung des Sozialen rücken die Diskursarten des Performativen und des Mentiologischen zusammen; im Ästhetischen kann niemals durch Worte gehandelt werden, weil diese Worte konsequenzungebunden sind. Freds Ästhetisierung seiner Rede als Romeo kann nur Folgen haben, wenn sie auf die soziale Ebene gebracht und dort missverstanden werden. Im ästhetischen Wahrnehmungsbereich des Subjekts als Selbst-Anders, das der Detective eben nicht mit Fred teilt, hätten diese Worte keine Konsequenzen.
Impossible Plumbing. Der Klempner und der Detective. Ihr langes, dennoch beredtes Schweigen, ihre vielsagenden Blicke, der Atem, den Nightingale vor der Äußerung seines fatalen Zitats holen muss, die Worte, die über die Lippen perlen, vielleicht ein Blick in die Ferne, der angehaltene Atem beim Detective, wie er wortlos von seiner Tischkante heruntergleitet, aus dem Zimmer geht. Die Einsamkeit des Klempners, der nach vielen Stunden wieder alleine ist, irritiert über die Abruptheit der Gestik des Polizisten. In den Zwischenräumen ihres Verhörs spielen die beiden Theater, das durch den Blick von außen erst sichtbar wird. Sie werden zu Akteuren ihrer Selbst und doch zu Selbst-Anderen ästhetisiert. Von diesem Potenzial der sozialen Wirklichkeit für den ästhetisierten Möglichkeitssinn des Erzählens im Dialogischen nimmt Impossible Plumbing seinen Ausgang.
Ein Host lädt einen Gesprächspartner an einen real existierenden Ort ein, an welchem im sozialen Alltag performative Sprechakte produziert werden. Dort führen die beiden ein Gespräch und entheben diesen Ort seines Alltags. Die beiden Gesprächspartner haben sich vorher noch nicht getroffen, kennen sich nicht und treffen sich: im Gerichtssaal, in der Notaufnahme des Krankenhauses, auf dem Parkett der Börse, im Auktionssal oder eben im Verhörzimmer der Polizei.
Ich sitze an einer Seite des Tisches, auf der anderen ein von mir geladener Gast. In einem Nebenraum, nur durch eine verspiegelte Glasscheibe getrennt, sitzt das Publikum. Mein Gast und ich versuchen, ins Gespräch miteinander zu kommen, wir tasten uns aneinander an, hören zu, sprechen, wir verhören uns, wir versprechen uns, wir treffen Aussagen, die als falsch entlarvt werden, wir sprechen die Wahrheit, die nicht nachzuprüfen ist. Mein Gast, sagen wir, es ist der bekannte Kriminalpsychologe, und ich sitzen an genau jenem Ort, an welchem normalerweise eine einzig mögliche Wahrheit gesucht wird: wer war es? Das Gespräch, dass mein Gast und ich führen, ist aber vollkommen frei von diesem Geständniszwang, vom Akt des Gestehens, der eine Schuld bekennt, und doch SPRECHEN wir die Wahrheit. Wir wissen, dass auf der anderen Seite Zuschauer sitzen, die uns sehen, wir aber sie nicht. Wir sind in diesem Verhörraum allein, ausgesetzt und doch unter Beobachtung gestellt. Mein Gast und ich halten uns 4 oder 5 Stunden in diesem Raum auf, versuchen, ein Gespräch zu führen über die Freiheit des Menschen angesichts der gegenseitigen sozialen Auslieferung, welcher wir uns aussetzen. Würde mich mein Gegenüber in einen Geständniszusammenhang bringen wollen, in dem ich etwas offenbare? Würde er mir, würde ich ihm das, was er sagt, was ich sage, als Wahrheit anbieten? Gäbe es so etwas wie ein Wissen um ein Sprechhandeln, wonach das, was ich sage, den Anderen in seiner Andersartigkeit herstellt? Dass ich ihm nur so begegnen kann, auf meine sozial vorgeprägte Weise? Dass dieser Blick, dieser Blick des Selbst-Anderen in mir, meines Theaters auf mich, ihn informiert? Meine Adressierung an ihn also gar nicht ihn meint, sondern dieses ‚Du’ hinredet an ihn? Dass die Verhandlung mit dem Anderen immer auch eine Handlung ist, ein Tun, nämlich eine Herstellung desjenigen, mit dem man dann verhandelt? Wer würde eine Rolle einnehmen, wie sie Fred Nightingale haben könnte, und wer wäre der Detective? Würde der kriminologische Diskurs des Enthüllens auf das Gespräch einwirken, könnte das Gespräch eine andere Rahmung aufnehmen, sich anders ästhetisieren? Gäbe es ein langes Schweigen?
In diesen Gesprächsinstallationen ist Tun, Handeln unmöglich. Im Gegensatz zu einem Installateur, der gerufen wird, um in einem Haus ein leckes Rohr zu reparieren, sind die Installateure des Gesprächs, die beiden Dialogpartner, nicht in der Lage, Schaden am System zu beheben. Während Polizei, Gericht, Arzt, Kirche soziale Reparatursysteme repräsentieren, die durch Sprechen Tatsachen herbeiführen und verändern können, sind die Dialoginstallationen entbunden von der Möglichkeit, mit Sprache das zu tun, was normalerweise an diesen Orten getan wird. Die Dialoge können mit ihrer Sprache nichts ausrichten, nichts tun, obwohl sie von einem symbolischen Ort aus sprechen, einem performativ-sozialen Punkt, an welchem durch Sprechen gehandelt wird, Dinge nicht nur angesprochen, sondern tatsächlich sprachlich hergestellt werden. Damit verschiebt die Installation des Dialogs an einem sozialen Knotenpunkt des Sprechhandelns den performativen Akt zu einem potenziell anderen, mentiologischen Sprechen des Wahrheit SAGENS. In dieser Verschiebung von Wahrheit zu ‚wahr sprechen’ öffnet sich vielmehr geradezu ein Leck, ein Loch im performativen System, das nicht zu stopfen ist, weil durch dieses ein anderer Sinn im Raum verströmt wird, weil es ein anderes Sprechen ermöglicht, eine andere Begegnung. Auch wenn die Dialogpartner, die unmöglichen Klempner nicht Rollen spielen, keine mimetische Wiedergabe sozialer Funktionen annehmen, agieren sie in jenem Sinne ‚als-ob’, als sie im gegebenen Real-Time-Setting diesen Funktionen ausgesetzt werden, diese aber fiktionalisieren. Sie tun das, was Fred Nightingale, dem Klempner, nicht gelungen ist: sich selbst anders möglich, selbst-anders unmöglich zu machen.
Das Gespräch, das keinem Drehbuch folgt, keinem vorgegebenen Text verpflichtet ist, bezieht seine Stichworte allein aus einem Raum, in welchem sich im doppelten Sinne zugleich das Öffentliche und Private kreuzen: Das Sprechzimmer des Arztes, das Gericht, die Kirche usf. sind öffentliche Räume, an denen doch das Allerprivateste verhandelt wird, sei es vor geladener Zeugenschaft (Gericht) oder fremden Menschen (Polizei, Arzt etc.), denen man sich anvertraut, anvertrauen muss. In diesen Räumen, die komplett von öffentlichen Texten (Gesetzen, Regeln, Verordnungen) konzipiert, zusammengehalten und durchlaufen werden, resonieren die privaten Geschichten derjenigen, die vorher oder nachher sich offen legen, befragt werden, Geständnisse ablegen, sie sind in jenem Sinne Erzählräume, als in ihnen Persönliches berichtet wird, wie sie auch das jeweils Persönliche quasi in jeder Mauerritze, in jeder Fuge ansammeln und ausströmen. Gleichzeitig greift die performative Sprachmacht, die in diesen Räumen alltäglich ausgeübt wird, in das Leben derer ein, die in diese Räume (vor-) geladen werden, dort vorsprechen sollen, dort verhört werden. Diese Räume sind demnach immer gleichzeitig öffentlich und privat, eine Eigenschaft, die durch die ästhetische Markierung der Gesprächsinstallation nochmals betont wird. Impossible Plumbing webt den jeweiligen Ort als Resonanzraum in den Gesprächsdialog unweigerlich ein, weil die in diesen sozialen Performanzräumen abgelegten Geschichten selbst Geschichte, Historie an der Fuge von öffentlichem und privatem Raum schreiben.
Theatralität und Politik des Gespräch. Impossible Plumbing stellt auch die Frage nach einer ‚Politik des Gesprächs’, die die dialogische Begegnung mit dem Gesprächspartner, dem Gegenüber immer schon durchläuft und beleuchtet. Wie sprechen mit dem Anderen? Was sagen zu ihm? Bereits jede Anrede, jede Adressierung der Rede an den ‚Anderen’ impliziert den Redner in der Position des Anderen, stellt den Adressaten an eine Position, an der das Ich nicht ist. Das ‚Du’ in ‚meiner’ Adressierung wäre dann lediglich eine Umadressierung von ‚mir’ zu ‚dir’, wenn das ‚Du’ eine Funktion eines ‚Nicht-Ich’ wäre. ‚Du bist immer schon anders, weil Du nicht Ich bist. Weil Du nicht Ich bist, weichst Du von Mir ab. Deine Differenz wird nur sichtbar, weil Du different von Mir bist. Mein Bezugspunkt, Meine Referenz zu Dir liegt damit ausschließlich bei Mir, nicht aber bei Dir, zu dem hin Ich aber dennoch sprechen will. Wie aber gelingt eine Adressierung, die den Anderen nicht als deviantes Ich, sondern als grundlegend different wahrnimmt, für wahr nimmt; wie aber sprechen, ohne sich immer nur selbst zu meinen und damit den Anderen grundsätzlich zu verfehlen? Wie die Gefahr überwinden, den Anderen immer nur als eine Abweichung des Redenden zu beschreiben?
Die gängigen Medien-, aber auch Sozialformate von Gesprächen funktionieren vor allem über jene rhetorische Techniken der Fehladressierung, Kunstfertigkeiten, die kaum andere Versuche der Begegnung zulassen. Sie wissen immer bereits, was der Andere zu sagen vermeint, weil sie aus ihm nur etwas herauslösen wollen, was sie in ihn hineingelesen haben. Mediale oder soziale Dialoge sind entweder Beglaubigungsformate einer wie auch immer gearteten vorgängigen Konstruktion von authentischen Ichs, die Anekdoten zum Besten geben müssen (Talkshows) oder enge Geständnisrhetoriken (Polizei, Arzt, Kirche), die das Ich erst als solches auftreten lassen; oder sie sind Reduktionsarten, in welchen sich äußernde Körper nur als Diskurse wahrgenommen und für wahr genommen werden sollen (Wissenschaft, Theorie). Das Ich kommt damit durch ein Gerede zum Vorschein, das aber immer schon durchlaufen ist von den Vorerwartungen der jeweiligen Sprecher und deren Gesprächs- und Sprechszenarien.
In der ästhetischen Begegnung mit dem Anderen liegt der Versuch der Horizontverschmelzung, welcher das Rätsel-Sein des Anderen gestattet; letzteres ist erste Bedingung für eine ästhetische Beschäftigung, die auch voraussetzt, dass der ästhetische Umgang immer auf ein Mehr an Erfahrung im Selbst abzielt. Und in dieser Erfahrung ist notwendigerweise ein anderes Wissen verborgen als im diskursiv Geäußerten. Die Sinnlichkeit des Gesprächs sperrt sich dabei der rein diskursiven Übertragung in die Ich-Information, weil sonst das im Ästhetischen Vielsagende in der auf Information reduzierten Übersetzung verstummen müsste. Die ästhetische Fassung, die die offene Begegnung mit dem Anderen ermöglichen soll, bringt die Singularität des Anderen zum Sprechen, reduziert dessen Diskurs aber nicht auf die Aussage eines Sinns, der ihm an-, nachgetragen wird. Vielmehr setzt in der ästhetisch doppelbödigen Setzung des Du als Anderen das Gespräch ein, indem das Ich sich dem Gegenüber aussetzt.
Es ist demnach die Möglichkeit eines unmöglichen Sprechens zueinander, aus welcher die Gesprächsinstallation ihren ästhetischen Mehrwert bezieht. Die Gesprächsperformance als Aufführung eines in-situ entwickelten Dialogs, in einer in eine Rauminstallation eingebetteten Redeimprovisation zieht einen Zwischenraum auf, in welchem die eingeladenen Gäste selbst-anders über sich sprechen. Sie sprechen damit nicht die Wahrheit über sich, ihre Geschichten, ihre Erlebnisse, ihre Gefühle aus, sondern sie sagen derer vieler. Es gilt auch, dass im möglichen Wissen um die unmögliche Adressierung an den Anderen, weil er in der Anrede bereits zum Anderen von mir gemacht wird, das Rätsel des Anderen erhalten bleibt. Weder das Ich soll übersetzbar gemacht werden, indem es etwa einem Verhör unterzogen werden würde, das den anwesenden Körper in reinen Diskurs zu transponieren trachtet, noch das Du, der Andere wird als nur abweichend angenommen; vielmehr steht dieses Du als unüberbrückbares Rätsel in seiner Leibhaftigkeit, in seiner Erfahrung, in seiner selbst-anderen Materialität dem Ich gegenüber. Dieses Du wird nicht als Herausforderung, Konfrontation, Provokation adressiert, die es zu überwinden gälte, sondern selbst als lebendige soziale Körperskulptur, welche gleichermaßen vom Sozialen als auch Ästhetischen überlagert ist. In diesem Wissen um sowohl die soziale (emotive, physische) Verfasstheit wie auch ästhetische Fassung des Gegenübers oszillieren die Gespräche. Darin liegt die Unmöglichkeit der Installation einer Wahrheit begründet, die sich nicht gänzlich im Diskursiven, im Sprechakt finden lässt. Die Rede tut nicht das, was sie sagt. Sie produziert nur im Lichte einer das Soziale immerfort reproduzierenden, stabilisierenden performativen Matrix Falschaussagen, wenn die Wahrheit der Rede gemessen wird an dem, was man gemeinhin Produktion von Authentizität nennt. Das ist kein widerständiges Trotzen, Aufbegehren gegen soziale Regeln oder Verträge, das ist ihre ästhetisch gefasste Materialität, die sich um so mehr verschleiert und sinnlich entfaltet, je länger man sie sprechen lässt. Diese Materialität lässt sich sinnlich erfahren, im Umgang der Gesprächspartner wie auch in der Wahrnehmung der Zuschauer. Entsprechend produzieren diese handlungsentlasteten Sprechakte der Gesprächsinstallationen eine andere Art von Performativa: Körper, die sich selbst-anders sind, die sich begegnen, beschnuppern und anfangen zu sprechen. Deren Materialität ist fehl an einem Platze, der gänzlich der Wirklichkeitskonstruktion durch Sprache vertraut. Die Sperrigkeit und Unübersetzbarkeit des Körpers in Sprache aber eröffnet andere Erfahrungsräume, andere Dimensionen der Wahrnehmung, die das Performative im Theater, als Theater wieder neu installieren.